In den letzten Wochen habe ich im Auftrag des Büros des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar den Fachtag „Kommunale Verantwortung in bewegten Zeiten“ organisiert, der am 15.9.2025 im wunderschönen Festsaal des Rathauses Weimar stattfand. Das war das Programm. Der Fachtag richtete sich ausdrücklich an gewählte Amtsträgerinnen und -träger aus Thüringer Kommunen und Mitarbeitende aus kommunalen Verwaltungen. Wir wollten einen geschützten Raum für einen offenen Erfahrungsaustausch untereinander bieten, und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und viele Mitarbeitende aus den Verwaltungen nahmen dieses Angebot wahr. Wir sprachen über die Ursachen für die zunehmende Konfrontation zwischen Gesellschaft und Verwaltung, aber auch über viele Möglichkeiten, die demokratische Resilienz vor Ort zu stärken. Hier einige (persönliche) Einsichten aus den Inputs unserer geladenen Gäste und den gemeinsamen Gesprächen:
Dirk Neubauer: Den Kampf um die Demokratie vor Ort annehmen
Sein Fall ging 2024 durch die Medien: Nach fast 10 Jahren im Amt des Bürgermeisters der sächsischen Kommune Augustusburg und anschließenden zwei Jahren als Landrat von Mittelsachsen trat er von diesem Amt zurück, weil die Anfeindungen aus Teilen der Gesellschaft und besonders die Bedrohungen aus dem rechtsextremen Lager einfach zu groß wurden. Er unterstrich, dass sein Fall nur einer von vielen sei. Denn tatsächlich liegt in der entstehenden Stimmung voll Aggressivität eine große Gefahr für die kommunale Demokratie, da sich mehr und mehr Menschen, insbesondere auch im ehrenamtlichen Bereich, aus der Kommunalpolitik zurückziehen und neue Kandidaten abgeschreckt werden.
Umso wichtiger sei es, sich bewusst zu machen, wie planvoll und strategisch gerade die Rechtsextremen in ihrer Partei und außerhalb vorgehen – und dem auch mit einem viel strategischeren Vorgehen zu begegnen. Hier sind vor allem die demokratischen Parteien gefordert. Zudem muss ein belastbarer Schutzschirm für Amtsträgerinnen und Amtsträger gespannt werden: Schutz- und Beratungsangebote bei digitalen oder analogen Anfeindungen, juristische Unterstützung, um aktiv gegen Anfeindungen vorzugehen. Kurz: mit den Instrumenten der wehrhaften Demokratie und des Rechtsstaats den Zersetzern der (Kommunal-)Demokratie offensiv begegnen. Hier sind vor allem die Länder in der Pflicht, sich schützend vor ihre Kommunen und die dort arbeitenden Meschen – ehren- und hauptamtliche – zu stellen.
Dr. Hendrik Träger: Mit Polarisierung leben lernen
Solange Polarisierung nicht in aggressive und demokratiefeindliche, gewaltbereite oder gewalttätige Extreme ausschlägt, ist sie nicht per se schlimm für die Demokratie. Der Leipziger Politikwissenschaftler plädierte dafür, Meinungsverschiedenheiten nicht immer gleich als „Streit“ negativ zu besetzen. Interessens- und Meinungsverschiedenheiten gehören in einer Demokratie dazu, auch wenn sie weit auseinander liegen. In einem stark auf Konsens orientierten Politikbetrieb haben wir in der Tat in den vergangenen Jahrzehnten offenbar das demokratische, konstruktive Streiten verlernt, und darüber auch die Kunst des Kompromissesuchens und vielleicht auch die Fähigkeit, Mehrheitsentscheide zu akzeptieren, auch wenn sie nicht unseren Ansichten entsprechen. Gerade die kommunale Ebene bietet mit ihrer Vielzahl an lebensnahen kommunalen Aufgaben ein hervorragendes Feld, um demokratisches Streiten anhand ganz konkreter Sachfragen (neu) zu lernen.
Christoph Ihling: Erfolge zeigen, Mut machen
Anfeindungen und Bedrohungen sind ein Fall für die Polizei und Justiz, genauso wie extremistische Gruppierungen, Bestrebungen und Taten. In den konkreten, täglichen Aufgaben der Kommunalpolitik ist es jedoch wichtig, positive Botschaften zu senden, Erfolge herauszustreichen und eben auch: eine gute Stimmung vor Ort zu pflegen, so der Oberbürgermeister von Eisenach. In aufgeheizten Situationen und nach den Logiken der sozialen Medien wird auch dies immer wieder die ‚Hater‘ von ihren Palmen herunterrufen lassen, auf die sie sich von jeder Kleinigkeit bringen lassen. Das sollte aber nicht den Blick darauf verstellen, dass die Mehrheit der lokalen Gesellschaften gern in ihrer Kommune lebt, und dass die meisten Menschen Erfolge würdigen und auf diesem Weg auch Vertrauen in kommunale Verwaltungen aufbauen können. Kompetenz in Sachfragen und ein bürgerfreundliches und offenes Auftreten sind die Ressourcen, mit denen sich Vertrauen wiedergewinnen lässt.
Dr. Angelika Maser: Angebote zur kommunalen Konfliktberatung nutzen
Wenn sich Fronten verhärten oder Konflikte eskalieren, hilft manchmal nur Hilfe von außen. Hierfür gibt es mittlerweile verschiedene Ansätze und Akteure der kommunalen Konfliktberatung. Die Mediatorin Dr. Angelika Maser arbeitet in verschiedenen Fällen für das „K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung“ mit Kommunalverwaltungen zusammen, um solche Konflikte in konstruktive Bahnen zu lenken und möglichst zu lösen. Sie berichtete aus einigen Fallbeispielen, was sehr aufschlussreich war. Besonders herausfordernd sind dabei Fälle, in denen Konflikte bereits ideologisiert oder personalisiert sind. Wenn das Wind- oder Lastenrad zum Hassobjekt wird oder Menschen zur Zielscheibe von Hass werden, ganz egal, was sie tun oder sagen, sind die eigentlichen Sachthemen und -ebenen meist in sehr weite Ferne gerückt. In Prozessen der kommunalen Konfliktberatung können aber auch so verhärtete Fronten stufenweise wieder auf die Sachfragen zurückgeführt werden, so dass ein Austausch über unterschiedliche Meinungen und Interessen wieder möglich wird.
Als Ansatz, der eigentlich aus der Friedens- und Konfliktforschung stammt, zielt die kommunale Konfliktberatung jedoch darauf, dass Konflikte möglichst gar nicht erst so weit eskalieren, dass es zu Ideologisierung oder Personalisierung kommt. In Zusammenarbeit mit Kommunen können daher Mechanismen und Verfahren entwickelt werden, die in konkreten Sachfragen von vornherein dazu beitragen, mögliches Konfliktpotential zu identifizieren und einen konstruktiven Umgang mit den Beteiligten zu suchen. Wie in der Medizin: lieber Prävention als Nachsorge. Es war daher sehr schön zu hören, dass viele Länder (und wohl auch Thüringen) das Potential der kommunalen Konfliktberatung erkennen und ihre Kommunen offenbar auch finanziell dabei unterstützen, solche Angebote wahrzunehmen.
Ist auch Versöhnung nötig?
Mich persönlich interessierte in dem Zusammenhang auch, welche Rolle „Versöhnung“ bei diesem Ansatz spielt. Ich glaube, dass viele der Konflikte der letzten Jahre – unabhängig von der Sach- und Personallage in der Kommune vor Ort – längst so ideologisiert und verhärtet sind, dass man ohne bewusste Prozesse der ‚Heilung‘ kaum noch zu einem normalen Miteinander zurückkehren kann. Jüngst hat der Bundestag die Enquête-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Krise eingesetzt. Es könnte hilfreich sein, so etwas auch auf kommunaler Ebene und in Form von Dialogformaten zwischen Verwaltung und Bürger:innen zu machen, auch bezüglich der verschiedenen Spaltungs-Themen: Corona, Migration, Krieg & Frieden. Das scheint mir besonders wichtig, um viele Menschen aus den Fängen der Populisten zurückzuholen.
Aus der Diskussion: Fehlerkultur, Ehrlichkeit & Transparenz vor Staatsumbau
Kommunen so ausstatten, dass sie ihrer Rolle gerecht werden können
In der Diskussion wurde schnell deutlich: Das Missverhältnis zwischen der Vielzahl der Aufgaben und Zuständigkeiten der Kommunen einerseits und der finanziellen Ausstattung und den Entscheidungsbefugnissen der Kommunen andererseits ist ein wichtiger, wenn nicht der zentrale Grund für das schwindende Vertrauen in die kommunalen Verwaltungen. Dann haben es auch populistische und extremistische Kräfte umso leichter mit ihrem Geschäftsmodell des ewigen Miesmachens und mit ihren Anfeindungen. Leider hatte unsere Runde nicht die Befugnis, daran etwas Grundsätzliches zu ändern – aber es ist immerhin ein wichtiger Teil der Problemdiagnose, der immer und immer wieder den Entscheider:innen auf Landes- und Bundesebene ins Gedächtnis gerufen werden muss.
Ehrlich sein: es geht nur miteinander
Vor dem großen Staatsumbau, der die Kommunen finanziell, vor allem aber auch politisch und hinsichtlich ihrer Kompetenzen fit für eine ‚glokale‘ Welt macht, liegen viele Instrumente zur Besserung aber auch schon bei den Kommunen selbst. Im Zentrum: An die Stelle eines Gegeneinanders von Verwaltung und lokaler Gesellschaft muss ein Miteinander treten. Viele der Ressentiments gegen Kommunalpolitik und kommunale Verwaltungen haben ihre Wurzeln in einer passiven Anspruchshaltung vieler Bürger:innen und Bürger. Das Bewusstsein, dass sich die Probleme vor Ort nur gemeinsam lösen lassen – das betonte Dirk Neubauer – könne man nur durch radikale Offenheit aktivieren: Klar machen, was die finanziellen Möglichkeiten sind, was Pflichten und Auflagen für Kommunen sind, was gemacht werden muss, was gemacht werden kann und vor allem: was nicht geht. Nur so werde klar, dass Kommunen keine Rundumsorglosanstalten sind, sondern dass in vielen Belangen das Mitmachen von allen nötig ist.
Mitnehmende Kommunikationskultur: Entscheidungen erklären, Fehler einräumen
Damit waren wir beim Punkt der Kommunikation. Das betraf einerseits die Frage nach geeigneten Kanälen. Wie bringen Kommunen in den Zeiten eines immer stärker ausgedünnten Lokaljournalismus und der Erregungsmaschine der sozialen Medien ihre Inhalte und Botschaften eigentlich an Mann und Frau? Klar: es muss digitaler werden, auch um der digitalen Hetzkommunikation, die immer öfter auch in geschlossenen Kanälen erfolgt, etwas entgegensetzen zu können. Auch hier wären durchaus die Länder gefragt, besonders um kleinere Kommunen mit den Mitteln, vielleicht aber sogar mit Plattformen (Apps) für digitale Kommunal-Kommunikation auszustatten. Aber auch der Wert von Eigenpublikationen wie Amtsblättern mit eigenen redaktionellen Teilen (egal ob gedruckt oder digital) wurde herausgestrichen. Verlässliche Informationen und Platz für die Erläuterung von Entscheidungen sind in Zeiten der Desinformation Gold wert – auch und gerade auf kommunaler Ebene.
Dies führte schließlich zu der Ermunterung zu möglichst radikaler Transparenz. Allzu oft werden Konflikte durch das Herauspicken von einzelnen Sachverhalten gezielt angeheizt. Dem kann man auch dadurch entgegenwirken, dass man die Rahmenbedingungen und Gründe für kommunales Handeln und Entscheiden möglichst umfangreich offenlegt und erläutert. Denn so entblößt man die häufige Böswilligkeit einseitiger Unterstellungen. Zu dieser Art der Transparenz gehört auch, Fehler im eigenen Handeln einzugestehen. Wenn man sagen kann: ‚Hier haben wir eine Sachlage falsch eingeschätzt.‘ oder ‚Hier haben wir nicht richtig informiert‘, dann nimmt auch dies der Böswilligkeit den Wind aus den Segeln. Und es zeigt, dass in kommunalen Verwaltungen auch nur Menschen arbeiten, die auch mal Fehler machen, aber gerade deshalb Respekt verdienen.
What next?
Zunächst: Das Format hat offenbar einen Nerv getroffen. Meinem Eindruck nach tat es den meisten Anwesenden sehr gut, sich einmal mit Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können, die vor ähnlichen Herausforderungen und in gleichen Handlungslogiken stecken. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine nannte es bei seiner Begrüßung scherzhaft eine Art Selbsthilfegruppe. Denn in der Tat: der Austausch von Erfahrungen und vielen Beispielen aus der Praxis zeigte allen, dass sie mit ihren Herausforderungen, teilweise auch mit ihrem Frust nicht alleine dastehen. Und es ermöglichte natürlich auch den Austausch über Lösungen und Wege, die gut oder weniger gut funktionieren.
Info-Veranstaltung zur kommunalen Konfliktberatung?
Mal sehen also, ob und wie solche Formate in Zukunft vielleicht öfter stattfinden können. Eine Sache ist bereits in Arbeit: Da das „K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung“ krankheitsbedingt nicht wie geplant durch dessen Leiterin, Dr. Ulrike Gatzemeier, vertreten war, und Frau Dr. Maser nicht für die gesamte Zeit der Veranstaltung anwesend sein konnte (großer Dank für das sehr spontane Einspringen!), möchten wir den Ansatz und die Möglichkeiten der kommunalen Konfliktberatung gern noch einmal in einer digitalen Veranstaltung etwas genauer vorstellen. „Wir prüfen das“… wie es so schön heißt. 🙂 Stay tuned.
Demokratie beginnt vor Ort
Mir wurde durch die Veranstaltung jedenfalls einmal mehr deutlich: „All politics is local“ heißt nicht nur, dass Landes- oder Bundespolitik auch zu Hause, in der Kommune ‚verkauft‘ werden muss, um die Wiederwahl zu sichern. Sondern im Gegenteil: dass die Wurzeln für demokratische Resilienz und eine demokratische politische Kultur in der Kommune liegen. Wenn man sich schon über Müllabfuhr, Kita-Bedarfsplanung oder den Straßenbau nicht zivilisiert, demokratisch und lösungsorientiert austauschen und verständigen kann: wie soll das dann in den großen Fragen unserer Zeit gelingen? Zeit also, es auch ‚im Kleinen‘ anzupacken…
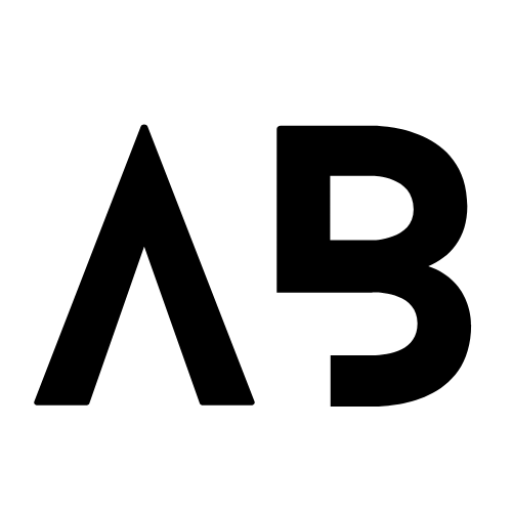

Schreibe einen Kommentar